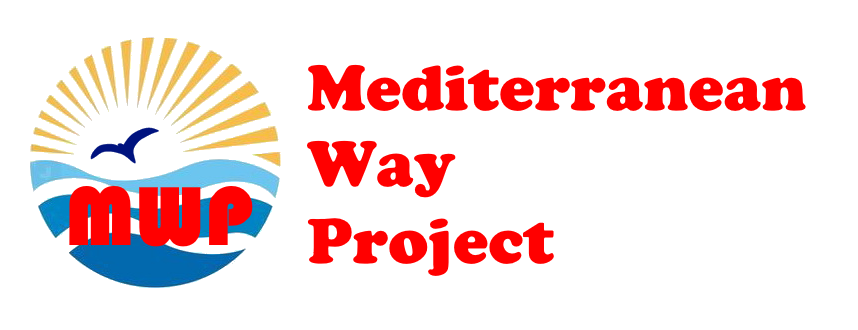Der Pontifex Maximus, ein Amt, das seit 2.700 Jahren besteht

Nur wenige wissen es, aber der Papst trägt den ältesten institutionellen Titel der westlichen Welt. Es ist nicht „Papst“, eigentlich. Es ist Pontifex Maximus. Und nein, das wurde nicht von der Kirche erfunden—es stammt aus der Zeit der Gründung Roms.
Der pontifex, wörtlich „Brückenbauer“, war der Priester, der die Verbindung zwischen Menschen und Göttern, zwischen Stadt und Göttlichem aufrechterhielt. Nicht durch Predigten, sondern durch das Wissen um die Riten, die richtigen Gesten, die heiligen Kalender. Im frühen Rom war das ein technischer Beruf. Spiritualität bedeutete eher Rhythmus und Tradition als Gefühl oder persönlichen Glauben.
In der Republik wurde der Pontifex Maximus das angesehenste religiöse Amt. Er überwachte öffentliche Riten, Hochzeiten, Beerdigungen, den Kalender, und verlieh politischen Entscheidungen religiöse Legitimation. Julius Caesar war Pontifex Maximus. Genauso Augustus, der als Kaiser wollte, dass dieser Titel—und seine symbolische Macht—für immer beim römischen Herrscher blieb.
Und so geschah es. Bis 370 n. Chr., als Kaiser Gratian, bereits Christ, den heidnischen Titel ablehnte. Doch der verschwand nicht. Er überließ ihn still und symbolisch dem Bischof von Rom. Seitdem sind die Päpste Pontifices Maximi—„oberste Brückenbauer“.
Die Robe änderte ihre Farbe, Tempel wurden zu Basiliken, Götter zu Heiligen, doch die Struktur blieb erstaunlich gleich. Ein Mann in Rom, in einem Gewand, spricht Latein und führt ein Reich—nicht mehr der Armeen, sondern der Gewissen.
Zu sagen, die Kirche sei das neu gebrandete Römische Reich? Vielleicht ein wenig zu viel. (Besser nicht übertreiben, sonst droht die Exkommunikation.) Aber es ist zweifellos eine faszinierende Kontinuität. Die christliche Welt erbte nicht nur den Glauben der Apostel—sondern auch das organisatorische Genie der römischen Religion. Heilige Ämter, Rituale, Hierarchien. Die Form blieb; die Seele wandelte sich.
Und doch ist da etwas Berührendes in dieser Kontinuität. Seit 2.700 Jahren suchen wir jemanden, der Brücken für uns baut. Zwischen uns und dem Göttlichen. Zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem. Zwischen Verzweiflung und Hoffnung.
Vielleicht brauchen wir das noch immer. Oder vielleicht nicht in Form eines Mannes in Weiß auf einem Balkon. Vielleicht müssen wir selbst pontifices werden. Unsere eigenen Brücken bauen. Zwischen unserem inneren Chaos und vergessenen Träumen. Zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir sein könnten.
Wenn wir uns spirituell verloren fühlen, suchen wir nicht immer eine Religion. Manchmal einfach nur Richtung. Eine bedeutungsvolle Geste. Einen Rhythmus. Eine Verbindung. Etwas Heiliges, aber Konkretes. Eine Brücke.
Und vielleicht ist das die tiefste Lehre dieses uralten Amtes: dass jeder von uns, früher oder später, berufen ist, ein pontifex zu sein—eine Brücke über das Unbekannte zu bauen, für sich selbst oder für einen anderen.